Der Medienkonsum Jugendlicher steigt. Deswegen wird mehr nachhaltige Medienbildung gefordert. Wie kann eine Medienbildung aussehen, die die individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen der Jugendlichen aufgreift und mitbedenkt? Nadia Kutscher, Professorin für Soziale Arbeit an der Katholischen Hochschule NRW, erläutert im Interview, dass insbesondere der Bildungshintergrund und die soziale Herkunft zu berücksichtigen sind, um eine nachhaltige Medienbildung zu realisieren.
Redaktion: Frau Prof. Kutscher, Ihre Arbeitsschwerpunkte sind u.a. Bildungsstrukturen, Entwicklungen in der Mediennutzung und soziale Ungleichheit im virtuellen Raum. Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen wird heute zu einem großen Anteil durch Computer, Internet, Handy, Fernsehen und Radio geprägt. Welche Entwicklungen sind hier in den letzten zehn Jahren zu beobachten? Und was interessiert die Jugendlichen heute besonders im Umgang mit Medien?
Kutscher: Im Laufe der letzten zehn Jahre hat sich die Mediennutzung zum Einen bedingt durch die technischen Entwicklungen stark ausdifferenziert, zum Anderen sind insbesondere “neue” Medien integraler Teil des Alltags von Kindern und Jugendlichen geworden. Eine besondere Entwicklung beobachten wir im Kontext der virtuellen sozialen Netzwerke. Sie sind mittlerweile zum zentralen Raum der Mediennutzung geworden, über den Kommunikation, Unterhaltung und Informationsaustausch stattfinden und werden auch von immer jüngeren Zielgruppen genutzt.
Redaktion: Unterscheidet sich demnach das Nutzungsverhalten der Jugendlichen von dem der Erwachsenen? Und resultiert ihr (unser) Nutzungsverhalten aus bestimmten Bedürfnissen, die wir verstehen lernen können?
Kutscher: Das Nutzungsverhalten von Jugendlichen und Erwachsenen hat durchaus Parallelen, insbesondere was das Volumen betrifft. Allerdings ist grundsätzlich das, was qualitativ in der Mediennutzung Jugendlicher stattfindet, auch typisch für ihre Altersphase und hat früher in anderen Formen oder Medien stattgefunden. Identitätssuche und Selbstausdruck, sich mit anderen ausprobieren, soziale Kontakte pflegen, Beziehungen aufbauen und sich darin erfahren, das sind alles klassische Entwicklungsaufgaben, die sich eben auch innerhalb der Medien, die zum Alltag der Kinder und Jugendlichen gehören, abspielen. Dies drückt sich beispielsweise darin aus, dass die Anzahl der Freunde in sozialen Netzwerken im Jugendalter extrem groß erscheint. Dies kann eher als Ausdruck dafür verstanden werden wie wichtig das “Sich in sozialen Zusammenhängen ausprobieren und erfahren” ist und weniger als Zeichen dafür, dass die Jugendlichen all diese Leute tatsächlich für enge FreundInnen halten.
Redaktion: Nicht nur der Zugang zu Medien, sondern insbesondere die Art der Nutzung ist entscheidend dafür, wie sich Kinder und Jugendliche entfalten können und in der Gesellschaft sozial und ökonomisch integrieren. Jugendliche sollen Medien in Kenntnis ihrer Chancen und Risiken selbstbestimmt einsetzen können – so eine oft formulierte Forderung im Bildungskontext. Warum ist die Förderung der Medienkompetenz eine zentrale Bildungsaufgabe und welche Herausforderungen ergeben sich daraus für den Bildungsbereich (auch für die Lehrenden)?
Kutscher: Vieles im Alltag, d.h. in der Freizeit, in der Arbeit und auch in Verwaltung und im öffentlichen wie politischen Leben wird mit Hilfe neuer Medien organisiert. Um daran teilhaben zu können, brauchen (nicht nur) Kinder und Jugendliche die Fähigkeiten und die Möglichkeiten, sich dieser Medienzugänge zu bedienen. Wir wissen allerdings aus vielen Studien, dass die Mediennutzung eng mit dem Bildungshintergrund und den sozialen Kontexten zusammenhängt. Dabei zeigt sich, dass sich die Mediennutzung entsprechend ausdifferenziert. Das heißt, die Nutzungsmotive, – also das, was innerhalb der Medien gemacht wird und das, was damit als Fähigkeiten und Wissen angeeignet, vertieft oder entdeckt wird – sind unterschiedlich anschlussfähig an das, was mehrheitlich als bildungsrelevant oder beteiligungsfördernd betrachtet wird. Viele Studien zeigen, dass die Schwerpunkte innerhalb der Nutzung entsprechend dem Bildungshintergrund, den sozialen Beziehungen und den finanziellen Möglichkeiten unterschiedlich ausgeprägt sind. Etwas verkürzt kann man sagen, dass die wirkmächtige Vertretung von Interessen und die Aneignung bildungsinstitutionell hilfreicher Fähigkeiten bei jungen Menschen mit vielen Ressourcen insgesamt betrachtet stärker ausgeprägt ist.
Bei sozial benachteiligten jungen Menschen spielen in der Mediennutzung hingegen vielfach eher unterhaltungsbezogene Aspekte und Identitätspräsentation eine Rolle. Dabei ist jedoch wichtig, dass sich bei den meisten Jugendlichen sowohl die Aneignung von Fähigkeiten als auch unterhaltungs- oder selbstdarstellungsbezogene Nutzungsweisen zeigen, in der Häufung bildet sich aber weiterhin eine Reproduktion ungleicher Teilhabemöglichkeiten ab, die auch außerhalb des Netzes bestehen. Diese Differenzierung hängt damit zusammen, welche Kompetenzen und Handlungsoptionen sich junge Menschen in ihrem Alltag aneignen können und das hängt wiederum davon ab, was in diesem Alltag als relevant und sinnvoll erlebt wird. Will man verstehen, welche Teilhabechancen sich in der Mediennutzung realisieren lassen, geht es darum, die Rahmenbedingungen der Jugendlichen in die Betrachtung mit einzubeziehen. Um also in diesem zentralen Feld, das auch künftige Teilhabechancen in Ausbildung, Beruf und Freizeit prägt, (nicht nur) junge Menschen entsprechend zu befähigen, muss Medienbildung integraler Bestandteil von Bildungsangeboten im gesamten Lebensverlauf sein. Grundsätzlich heißt das, dass pädagogisch Tätige in der Arbeit mit jungen Menschen und ihren Familien das Thema Medien als selbstverständlichen Teil von Bildungsangeboten einbeziehen müssen, da sich in diesem Themenbereich vieles abspielt, das grundlegende Bildungsfragen betrifft. Dieses Anliegen vertritt unter anderem die Initiative “Keine Bildung ohne Medien”.
Redaktion: Sie haben sich insbesondere mit der Medienbildung im Kontext der Ganztagsschule auseinandergesetzt. Der schulische Ganztag zeichnet sich durch eine größere zeitliche Flexibilität aus. Inwiefern birgt dies Chancen für die Auseinandersetzung mit medienpädagogischen Themen?
Kutscher: Es kommt zunächst darauf an, von welcher Art der Ganztagsschule wir sprechen. Da es verschiedene Formen gibt, die von klassischem Vormittagsunterricht und nachmittäglicher Betreuung in offenen Gruppen oder Arbeitsgemeinschaften bis hin zu rhythmisierten Ganztagsschulformen reichen, sind die Rahmenbedingungen für größere zeitliche Flexibilität sehr unterschiedlich. Darüber hinaus ist die Bandbreite an Modellen mit Angeboten von nichtpädagogischen Honorarkräften bis hin zu sozial- oder schulpädagogischen Fachkräften groß. Die Konzepte der Schulen differieren ebenfalls weitgehend. Es ist natürlich ein Unterschied, ob sich der Nachmittag als reine Verlängerung des Unterrichts gestaltet oder ob hier neue Bildungsangebote entstehen, die sich unabhängig von schulischen Bewertungssystemen an den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Jugendlichen orientieren. Prinzipiell besteht jedoch die Möglichkeit, dass im Rahmen der Verzahnung von unterrichtlichen und außerschulischen Angeboten eine größere Kontinuität oder Vertiefung von medienbezogenen Inhalten und Angeboten möglich wird oder auch gerade ohne Unterrichtsbezug eine freie Medienbildungsarbeit angeboten wird, die die Jugendlichen bei ihrer Medienaneignung begleitet.
Redaktion: Wie lässt sich das Mediennutzungsverhalten der Schüler und Schülerinnen im Ganztagsschulbetrieb gezielt so einsetzen, dass sie Freude am Umgang mit Medien haben oder entwickeln und durch den Umgang gleichzeitig ihre fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen gestärkt werden?
Kutscher: Zuerst geht es darum, dass sich die Pädagoginnen und Pädagogen das Mediennutzungsverhalten der Jugendlichen und die Voraussetzungen ihres spezifischen Medienhandelns bewusst machen. Vor diesem Hintergrund sollte dann nicht die Orientierung an festen Zielvorgaben oder vorstrukturierten Konzepten im Vordergrund stehen, sondern eine flexible, zielgruppensensible Konzeptentwicklung gemeinsam mit den Jugendlichen stattfinden. Die Aufgabe der Pädagoginnen und Pädagogen dabei wäre dann die Initiierung und Begleitung von Prozessen, die auf die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten und Selbstwirksamkeit der Jugendlichen in der Mediennutzung zielen. Konkret heißt das, Alltagssituationen aus den Relevanzkontexten der Jugendlichen aufzugreifen und zu versuchen zu verstehen, wo und wie Medien ihnen bei ihrem Lebensalltag hilfreich sind. Davon ausgehend können dann weitere Situationen entwickelt werden, in denen die jungen Menschen erfahren, welche Möglichkeiten ihnen eine spezifische Mediennutzung noch eröffnen kann.
Dabei gilt es, die Machtverhältnisse in der Schule, die den Rahmen mit prägen, zu reflektieren und zu überlegen, welche Angebote besser im unterrichtlichen und welche besser im bewertungsfreien, außerschulischen Bereich realisiert werden. Das bedeutet, dass eine stark persönlichkeitsbildende Arbeit, die viel Offenheit und Vertrauen seitens der jungen Menschen erfordert, vielfach durch das Bewertungssystem (“früher oder später ist der, dem ich jetzt Dinge offenlegen soll, derjenige, der mir eine Note gibt”) konterkariert wird. Da ist es dann transparenter und fairer, wenn diese Machtverhältnisse nicht verschleiert werden und hingegen ein anderer Bereich der persönlichkeitsbildenden pädagogischen Arbeit vorhanden ist, in dem gegenüber den Jugendlichen keine Bewertungsmacht besteht. So kann ein besonderer Freiraum für die Entdeckung und Entfaltung neuer Wege eröffnet werden.
Redaktion: Die Chancen und Risiken des Mediennutzungsverhaltens der Jugendlichen werden häufig thematisiert – im Bereich Risiken jedoch meist nur im Zusammenhang mit Cyber- Mobbing oder Datenschutz. Sie beschäftigen sich auch mit “sozialer Ungleichheit im virtuellen Raum”? Was verbirgt sich dahinter?
Kutscher: Mit sozialer Ungleichheit im virtuellen Raum oder auch “Digitaler Ungleichheit” ist gemeint, dass sich innerhalb der Internetnutzung soziale Ungleichheiten reproduzieren, die damit zu tun haben, dass Ressourcen wie Bildung, finanzielle Möglichkeiten und damit verbundene soziale Beziehungen ungleich verteilt sind und sich so auch das, was im Internet geschieht, entsprechend ausdifferenziert. Das macht sich beispielsweise daran fest, dass – wie empirische Studien zeigen – die Nutzungsmotive und -praktiken unterschiedlich sind, je nachdem in welchen lebensweltlichen Alltag sie eingebettet sind. So überschreiten inhaltliche Interessen und Beziehungsnetzwerke auch im Internet eher selten die Milieugrenzen, auch wenn es auf den ersten Blick manchmal vielleicht so aussieht. Insgesamt ist es so, dass die meisten jungen Menschen das Internet nutzen, aber das, was sie darin tun und was dadurch für sie an gesellschaftlicher Teilhabe möglich wird, ist wie gesagt entsprechend ihren Ausgangsressourcen ungleich verteilt. Das gilt für Beteiligungsaktivitäten wie die Vertretung eigener Interessen, die Anerkennung von bestimmten Anliegen, für bildungsinstitutionell anschlussfähiges Wissen und erwartete Fähigkeiten, aber auch dafür, wer mit wem kommuniziert und sich vernetzt.
Redaktion: Wie sieht eine “ungleichheitssensible Medienbildung” aus – also eine Medienbildung, die an die Lebenswelten und Ressourcen der Jugendlichen anknüpft und diese berücksichtigt – und können sozial benachteiligte Jugendliche von der Medienarbeit in der Ganztagsschule besonders profitieren – unabhängig von der Schulform? Warum?
Kutscher: Eine ungleichheitssensible Medienbildung beginnt nicht mit einem festen Konzept, sondern damit, dass sie an den lebensweltlichen Logiken der jeweiligen Zielgruppe ansetzt. Das heißt, das Angebot nicht von einem Qualifikationsziel, sondern von den AdressatInnen, ihren Möglichkeiten und Interessen her zu entwickeln. Dazu müssen einerseits zunächst die Voraussetzungen, die die Kinder und Jugendlichen mitbringen, reflektiert werden. Andererseits ist es wichtig, die Frage zu stellen, in welchen Alltagskontexten der jungen Menschen das, was vermittelt werden soll, Anwendung finden kann und inwiefern sie das vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen als “lebensdienlich” erleben können. Wichtig ist eine Offenheit und Prozessorientierung in den Angeboten und eine personelle und strukturelle Kontinuität, insbesondere bei den Zielgruppen, die aus einem Alltag kommen, der wenig anschlussfähig an bildungsinstitutionelle Anforderungen ist. Denn wir wissen, dass Beziehungen eine entscheidende Grundlage dafür sind, dass diese jungen Menschen sich auf etwas Kontinuierliches einlassen können. In einem längeren Prozess, der erst einmal bedeutet, sie und das, was ihnen wichtig ist, anzuerkennen, können ihnen weitere Möglichkeiten eröffnet werden.
Konkret geht es darum, weniger curricular und kognitiv strukturiert, kleinschrittiger und mehr an kommunikativen und präsentativen Formen orientiert zu arbeiten. Das bedeutet, viel Austausch zu ermöglichen, visuelle und selbstdarstellerische Aspekte zu integrieren, in denen die Jugendlichen sich erst einmal selbst ausdrücken können und nicht als erstes etwas mit dem pädagogischen Zeigefinger vermittelt bekommen. Das hört sich alles vielleicht banal an, die Erfahrung zeigt aber, dass in der medienpädagogischen Arbeit oder in der Schule vielfach immer noch vorgefertigte Konzepte der Ausgangspunkt von Angeboten sind, die dann mehr oder weniger mit den Anliegen der Jugendlichen verbunden werden oder eben daran vorbeigehen.
Redaktion: Kann diese Medienbildung so weit gehen, dass sie insbesondere benachteiligte Jugendliche dabei unterstützen kann, am sozialen, kulturellen und politischen Leben teilzuhaben und selbstständig zu handeln? Wie können Medien ihre kommunikativen und kreativen Fähigkeiten anregen?
Kutscher: Zunächst denke ich, dass die kommunikativen und kreativen Fähigkeiten der jungen Menschen nicht angeregt werden müssen, wenn sie ernst genommen werden – denn sie sind da. Wir müssen uns eher fragen, durch welche Angebote und pädagogischen Formen wir es bislang leider oftmals schaffen, ihnen diese Fähigkeiten auszutreiben. Pädagoginnen und Pädagogen sind daher gefordert, zunächst anhand der Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen zu verstehen, was sie beschäftigt um daraus gemeinsam mit ihnen zu erarbeiten, wo und wie Medien ihnen in ihrem Lebensalltag hilfreich sein können – immer unter Berücksichtigung ihres Bezugsrahmens. Darauf aufbauend kann eine weiterführende Medienkompetenzentwicklung im Sinne qualifikationsorientierter Kenntnisse und Fähigkeiten stattfinden. Dafür müssen aber erst die „Basics“ stimmen, d.h. die jungen Menschen müssen erfahren, dass sie und ihre Erfahrungen und Anliegen ernst genommen werden.
Redaktion: Was bedeutet “Medienpädagogische Fachkompetenz”? Inwiefern muss sich auch die Ausbildung der Lehrenden verändern, damit sie angemessen auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen können?
Kutscher: Wir brauchen eine prozessorientierte Aus- und Weiterbildung von pädagogisch Tätigen, ob in Schule oder Kinder- und Jugendhilfe, die Haltungen und Grundwissen über Mediennutzungspraxen der Zielgruppen, Alltagsrelevanzen und medienpädagogische Grundlagen sowie verschiedene methodische Ansätze vermittelt. Das bedeutet, nicht in eintägigen Kursen Wissen zu vermitteln, sondern vielmehr begleitend über längere Zeiträume im pädagogischen Alltag Prozesse des Ausprobierens, der Reflexion und der Entwicklung sowohl neuer Haltungen als auch neuer Ansätze zu ermöglichen. Entscheidend dabei ist,in Fortbildungen zu verdeutlichen, dass dieses Wissen nur die Basis liefert, mit der flexibel und zielgruppensensibel jeweils unterschiedliche Ansätze zu suchen sind und dass es kein fertiges Konzept oder Patentrezept für Medienbildung gibt, wenn die Perspektive der Zielgruppe angemessen berücksichtigt werden soll.
Redaktion: Frau Prof. Kutscher, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Weiterführende Informationen: Nadia Kutscher ist Mitglied der Sachverständigenkommission für den 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung und Mitautorin der Expertise “Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen” für die Landesanstalt für Medien NRW, veröffentlicht im Jahr 2009.
Foto: flickr/eekim


 Die Werkstatt der bpb freut sich auch in Zukunft über spannende Diskussionen zum Thema digitale Bildung!
Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Tetra Images
Die Werkstatt der bpb freut sich auch in Zukunft über spannende Diskussionen zum Thema digitale Bildung!
Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Tetra Images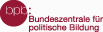



Kommentare